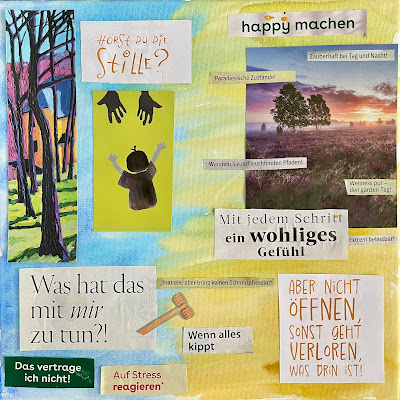Auf Anfrage gegen Weihnachten 2023 hin hat
mir meine Mutter eröffnet, dass ich die ersten vier Lebensjahre - ab dem 3
Monat - im Kinder-Wochenheim der DDR war. Vorher war ich nur von einem Jahr Wochenkindergarten ausgegangen, denn über diesen haben wir immer mal wieder gesprochen.
Dies ist die Whatsapp Kommunikation mit meiner Mutter dazu:
Rico:
"Ich habe gerade ein ganz interessantes Buch zu Wochenkindergärten
gefunden. Kannst du mir bitte noch mal sagen, von wann bis wann ich dort
war? Ich finde es unheimlich spannend, mich zur eigenen Persönlichkeit
weiter zu bilden." Mutter: "Wegen der Wochenheime hab ich
keine Unterlagen. Die Erinnerung ist nicht ganz vollständig. Du warst in
einer Wochenkrippe am Schillerplatz bis zum 3. Geburtstag und
anschließend im Wochenkindergarten in Rochwitz. Ich weiß aber nicht
mehr genau, wie lange. Der wurde irgendwann geschlossen und dann warst
du in einem normalen Kindergarten in Dresden."
Rico: "Hast du
noch eine Idee vom Eintrittsalter in die Wochenkrippe? Eher 3 Monate, 6,
9 oder 12. So ungefähr? Und ob die Krippe eine staatliche war? Ich
würde gerne an einer (anonymen) Unistudie teilnehmen, die gerade läuft.
Das wäre sehr nett von dir und würde mir sehr weiterhelfen!"
Mutter: "Das war staatlich. Private gab es sicher damals gar nicht. Und ja - ab 3 Monate."
Wie
man auf dem Bild sehen kann, war es aber doch eine betriebliche
Einrichtung, nämlich die Wochenkinderkrippe "Lilo Herrmann" der VEB
Verkehrsbetriebe Dresden auf der Waldparkstr. 6.
Eine weitere Whatsapp-Unterhaltung mit meiner Mutter fand dann am im Januar 2024 statt:
Ich: "Hallo Mutti, wärst du bereit dazu, dich mit mir mal zum Thema Wochenkrippe zu unterhalten? Mir würde es hauptsächlich um Erinnerungen aus dieser Zeit gehen. Ich habe selbst ja kaum welche. Das wieso und warum ist mir nicht so wichtig. Ich würde mir ein paar Fragen ausdenken, die wir abarbeiten könnten. Ist das möglich?
Mutter: Klar ist das möglich. Warum, das kann ich dir auch beantworten. Ich hab als Pferdepfleger gearbeitet und geteilten Dienst gehabt. Früh 6-11Uhr und nachmittags 16-18Uhr und das auch Samstag. Erinnerungen an die Zeit hab ich auch nicht mehr viele. Aber ich beantworte gern Fragen wenn ich kann.
Ich: Vielen lieben Dank. Ich denk mir mal ein paar Fragen aus und melde mich dann wieder.
...
Hallo, ich habe ein bisschen nachgedacht und eigentlich habe ich nur drei Fragen, wovon die erste ein bisschen umfangreicher ist. Wie war ich als Kind im Alter von 0-4 Jahren, wie habe ich mich verhalten? Wie ist dir die Wochenkrippe noch in Erinnerung, etwa Personen und Gebäude? Die Krippe war übrigens von den Dresdner Verkehrsbetrieben und befand sich auf der Waldparkstr. 6. Den Kindergarten habe ich nicht gefunden, in Rochwitz gab es nur ein Jüdisches Kinderheim. Wie war die Wohnungssituation in dieser Zeit? Ich kann mich nur an die Wohnung von Oma Lotte erinnern. Haben wir da zu dritt gewohnt? Oder gab es schon eine andere Wohnung?
Mutter: Ja, die Betreuung auf der Waldparkstraße war sehr gut. Weil du ja mehr dort als bei mir warst, hast du manchmal geweint, als ich dich abgeholt habe. Konkrete Erinnerungen an die Erzieherinnen habe ich nicht. Anders war es in Rochwitz. Mit 3 Jahren hattest du schon eine stärkere Bindung zu mir. Da hast du dich gefreut, wenn ich kam. Montags früh sind wir immer schon 6 Uhr mit dem Bus 84 wieder hoch gefahren. Die Adresse weiß ich leider nicht mehr, auch nicht die Haltestelle. Aber das Heim war zu der Zeit in keiner Weise religiös. Erinnern kann ich mich nur noch daran, dass ich gerügt wurde, weil ich nicht zum Elternabend kam. Das ging aber nicht, weil du abends nicht allein bleiben wolltest.
Bei Oma Lotte gab es auch noch den Opa Otto. An den kannst du dich wohl nicht erinnern? Wann wir umgezogen sind auf die Wiesenstraße, weiß ich auch nicht mehr genau. Zu der Zeit warst du im Kindergarten Altseidnitz. Da kann ich mich noch an die Erzieherin Frau Keil erinnern, die meist Spätdienst hatte.
Ich: Ja, an Opa Otto kann ich mich dunkel erinnern, auch an sein Begräbnis. Ich habe die Wohnung als 2-Raumwohnung in Erinnerung, deswegen habe ich mich gewundert, wie dort 4 Personen gewohnt haben… Das einzige Wochenheim Richtung Rochwitz war auf der Kottmarstr. 1. Die Haltestelle dazu heißt „Zweibrüderweg“. Das ist zwischen Loschwitz und Niederrochwitz.
Mutter: Die Wohnung auf der Schlüterstraße war eine 3-Raumwohnung. So hab ich das Gebäude nicht in Erinnerung. Aber vielleicht irre ich mich auch. Ich hab gerade gelesen, bei Wochenkindern soll es Entwicklungsverzögerungen gegeben haben in den Bereichen Bewegung und Sprache in den ersten 2 Jahren. Das trifft aber bei dir nun wirklich nicht zu. Da warst du besser als die Mädels (Anm.: meine 2 Schwestern).
Ich: Naja, es gab sicher viele Unterschiede zwischen den Einrichtungen und zwischen den Jahrgängen. Am Anfang hat man viele Fehler gemacht und das wie ein Krankenhaus aufgezogen. Später gab es dann ordentliche Erziehungspläne. Manche Einrichtungen waren chronisch überbelegt oder hatten ständig wechselndes Personal. Da hatten die Kinder dann natürlich Probleme damit.
Mutter: Überbelegung war damals kein Thema. Da war einfach Aufnahmesperre. Und Personalwechsel ist auch eher ein Thema von heute. Ob aber das Personal überall gut war, kann ich natürlich nicht beurteilen.
Ich: Es gibt darüber erstaunlich detaillierte Archive und (mittlerweile) historische Untersuchungen auf dieser Basis. Also in Rochwitz selbst gibts 2 Kandidaten, das eine Haus liegt auf der Hutbergstr. 1 und ist immer noch ein Kindergarten. In der Nähe gibts auch einen Schulhort, auf der Hutbergstr. 2. Das andere liegt auf der Karpatenstr. 37 und war vor dem Krieg ein Kindererholungsheim, wurde aber nach dem Krieg als Wohnhaus bzw. Bürogebäude genutzt.
Mutter: Von den Fotos her würde ich auf Hutbergstraße tippen. Also das 1. Foto."
Der Ursprung für den folgenden Text sind Beiträge aus dem Forum "Storming Brains", in dem ich Mitglied bin:
Die Wochenkrippe war also damals eine ideologische und logistische Maßnahme zur Befreiung der weiblichen Arbeitskräfte von der Mutterschaft.
Jetzt kann ich alle meine weirden Macken dahin schieben.Tatsächlich hat
frühkindliche Säuglingsheimverwahrung weitreichende Auswirkungen auf
die Persönlichkeitsentwicklung (eben Hospitalismus), wobei es durchaus
Überschneidungen mit Autismus und ADS gibt (Kommunikationsstörungen,
fehlerhafte Mimikinterpretation, Ablenkbarkeit, Festhalten an
Gewohnheiten).
Hervortretend sind aber im Gegensatz zu diesen: Angststörungen,
Bindungsprobleme bis zur Unfähigkeit, Empathieminderung, Überanpassung,
ausgeprägte Selbstständigkeit (niemanden brauchen, "Scheinbare
Selbstständigkeit"), niedriges
Selbstwertgefühl, gestörtes Gefühlsempfinden (deswegen psychosomatische
Probleme).
Ein Teil davon entsteht, weil der Stress Botenstoff Cortisol die
Verarbeitung von inneren und äusseren Wahrnehmungen in verständliche
Gefühle blockiert. Durch fehlende oder negative Spiegelung der
Bezugsperson entsteht ausserdem möglicherweise "toxische Scham", bei der man sich als "falsch", "abstoßend", "wertlos", "überflüssig", "anders" und "nicht zugehörig" empfindet.
Bei
mir trat folgendes auf: Ich konnte meine Gefühle oft nur mit Hilfe von
einer anderen Person erkennen (Mimik). Ich fühlte mich oft wie ein totes
Stück Holz und hatte auch keine gute Temperaturwahrnehmung. Bei
stressigen Situationen gerate ich manchmal in einen Totstellreflex
(Freezing) oder wechsele in eine Art äusseren Betrachter, der nur
zuschaut oder schlagfertig lakonisch kommentiert. Ich kann aber auch
einfach nur „funktionieren“, eine Art Robotermodus, in dem ich arbeite, ohne auf mich selbst zu achten. Ich hatte und habe, aufgrund von stressbedingten Verspannungen und Fehlhaltung Schmerzen in den Muskeln am ganzen Körper. Ich bin
wenig emphatisch und kann Emotionen anderer Menschen schlecht zuordnen.
Meine Frau merkt noch an, dass ich von meiner Familie entfremdet bin,
mich nicht über Erfolge freuen kann und meine Gefühle und Wünsche schwer
verbalisieren kann.
Ich nehm natürlich auch gleich, sowie auch viele andere Wochenkinder, an einer Psychostudie der Uni Rostock
teil, sollen ja auch ein paar Doktoranden was von meiner Macke haben.
Ich habe es erst
jetzt komplett erfahren, vorher war ich nur von einem Jahr Wochenkindergarten ausgegangen.
Ich habe kaum Erinnerungen daran, da war ich zu klein. Nur wenige
Bilder. Scheint also nicht so spannend gewesen zu sein.
Ja, man bleibt dabei die ganze Arbeits-Woche im Heim, auch nachts. In
einem Schlafsaal mit vielen anderen Kindern und einer Aufsicht. Grausam ist nicht das Heim an sich, es ist sogar ganz nett da. Fehlt nur
die persönliche Zuwendung. Jedes Kind bekam pro Tag durchschnittlich
eine halbe Stunde Aufmerksamkeit von einem Erwachsenen. Es ist eine Art
schmerzlose (weil man sich
nicht daran erinnert) Operation, nachder man nicht mehr richtig fühlen
kann oder man selbst ist. Wie es in dem Buch „Der Goldene Kompass“ mit den
Kindern und ihren Tierdämonen passiert. Die DDR an sich war nicht für alle Kinder
schlecht. Nur für die die Pech hatten.
Wütend
bin ich,
aber eher diffus. Nach all der Zeit kann man das an niemandem mehr
auslassen ausser meiner Mutter und selbst die ist 72. Das bringt nix
mehr. Sie war damals alleinerziehend, musste arbeiten und bekam keinen
Tageskrippenplatz, der auf dem Arbeitsweg lag und wo die Krippe lang genug geöffnet hatte. Mein Vater ist damals
nach Westdeutschland ausgereist. Bezugsperson war meine Urgroßmutter, bei der ich oft meine
Wochenenden verbrachte. Die war allerdings damals 74 Jahre alt, also
begrenzt bespielbar.
Die Betreuung im Heim lief nach dem Uhrwerk, ein Pfleger auf 10
Kinder. Sobald man laufen konnte, wurde eventuell sogar ein Tambourin
benutzt, um
das Taktgefühl zu verbessern. Marschieren rund um den Tisch und
dergleichen habe ich auch am Wochenende mit meiner Uroma gemacht.





 Rot – der Körper ist sehr aufgeregt.
Rot – der Körper ist sehr aufgeregt. Gelb – eine leichte Unruhe oder Anregung ist spürbar.
Gelb – eine leichte Unruhe oder Anregung ist spürbar. Grün – völlige Entspannung.
Grün – völlige Entspannung.